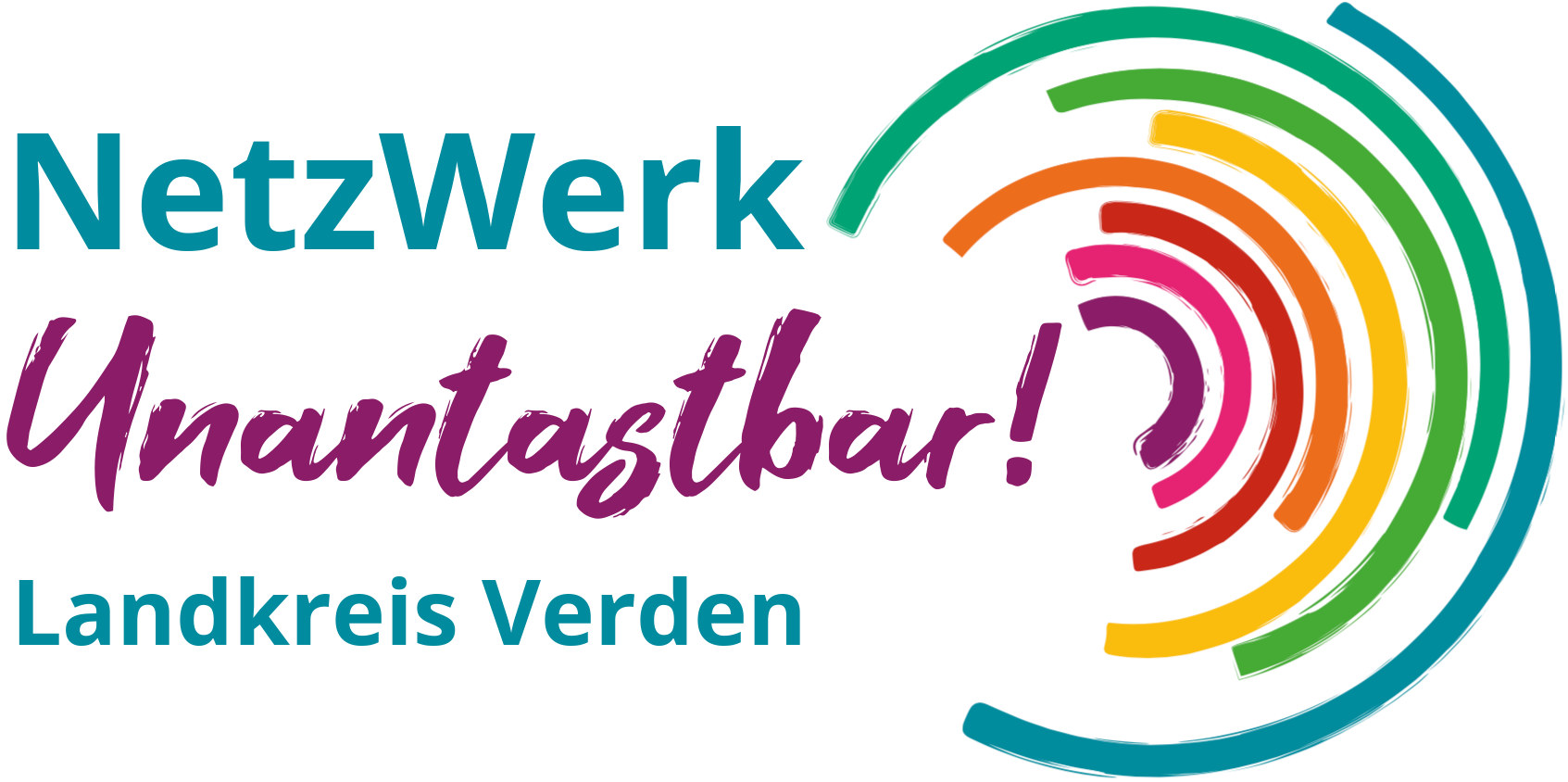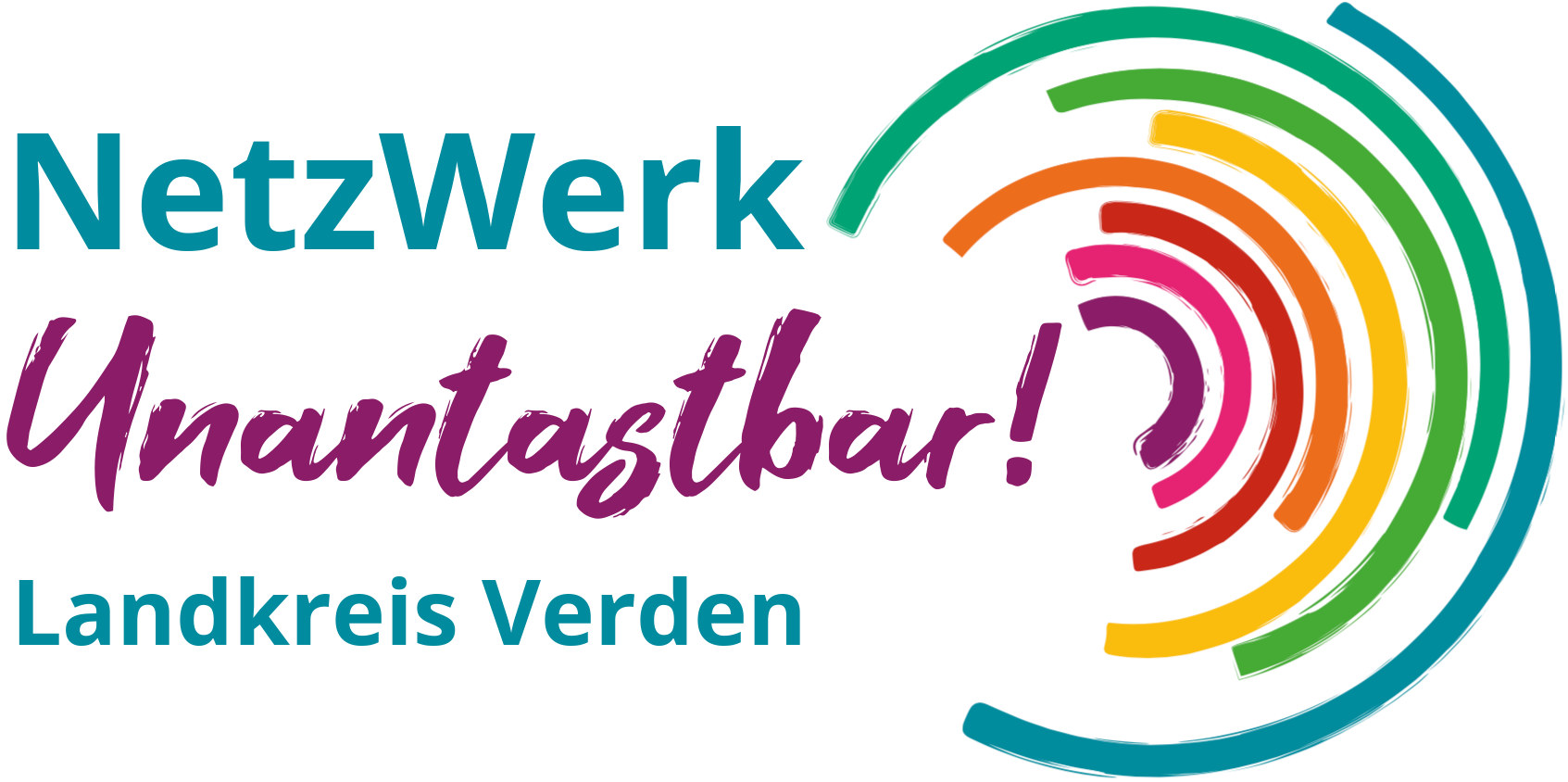Ein Jahr nach Hanau

Gegen das Vergessen Hanau © Pixaby
Gökhan Gültekin, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Hamza Kurtović, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov wollten den Abend mit ihren Freundinnen und Freunden verbringen und wurden kaltblütig ermordet.
Der rechtsextreme Täter, der an diesem Abend auch seine pflegebedürftige Mutter und sich selbst tötete, wählte die überwiegend jungen Menschen nicht zufällig. Die meisten von ihnen lebten schon länger mit ihren Familien in Hanau. Die Opfer waren Mutter und Tochter, Vater, Söhne und Brüder. Sie arbeiteten als Angestellte und Selbständige oder beendeten gerade erfolgreich ihre Lehre. Sie waren deutsche und/oder ausländische Staatsangehörige.
Vom Täter wurden sie in erster Linie als migrantisch gelesen. Es ist bekannt, dass der Täter die späteren Tatorte zuvor aufsuchte und gezielt auswählte, weil Gäste der Cafés einen von ihm verhassten „Migrationshintergrund“ besaßen. Er veröffentlichte ein fremdenfeindliches, völkisch grundiertes Pamphlet im Internet, um seinen rassistischen Hass zu verbreiten. Und er trainierte seine Schießfähigkeiten regelmäßig im Schützenverein. Seine von einem Gutachter als „planvoll vorbereitet" bezeichneten Taten unterliegen der gleichen rassistischen Weltanschauung wie die Attentate von Utøya oder Christchurch. Sie sind mitnichten die spontanen Taten eines unpolitischen, psychisch kranken Amoktäters.
Die Überlebenden und Hinterbliebenen kämpfen derweil mit ihren traumatischen Erfahrungen. Und sie kämpfen mit kreativem Aktivismus für lückenlose Aufklärung und gegen das Vergessen eines Verbrechens, das schon wenige Wochen später durch die Pandemie medial verdrängt wurde. Die „Initiative 19. Februar“ hat in Sichtweite des ersten Tatorts in einem Laden einen Ort der Begegnung geschaffen, an dem Menschen trauern, gedenken und sich unterstützen können. Der für alle offene, spendenfinanzierte Treffpunkt soll auch ein Ort der Mahnung sein.
Der Mahnung Anlass gibt es aus Sicht der Betroffenen genug. Zum Beispiel ist bis heute unklar, warum der Täter den zweiten Tatort lange vor der Polizei erreichen konnte, obwohl Vili Viorel Păun diesen mit seinem Wagen verfolgte und dabei mehrfach erfolglos versuchte, die Polizei zu benachrichtigen, bevor er selbst vom Täter erschossen wurde. Warum erfuhr der Vater eines Opfers erst am nächsten Tag aus dem Internet vom Tod seines Sohnes, obwohl er die Polizei mehrfach in der Nacht um Auskunft bat? Warum war ein psychisch auffälliger Mann, der seine Wahnvorstellungen lange vor den Morden u.a. der Generalbundesanwaltschaft mitteilte, im Besitz eines Waffenscheins? Warum darf der Vater des Täters medienwirksam die Tatwaffe zurückfordern, die Mordopfer als „Täter“ und „Fremde“ bezeichnen und gegen das Gedenken agitieren?
Anlass zur Mahnung geben auch reflexartig abgegebene Äußerungen von AfD-Mitgliedern, die nach der Tat wiederholt die Erzählung eines psychisch kranken Einzeltäters bemühten und das rassistische Motiv der Tat zunächst ausblendeten. Warum wehrt sich Horst Seehofer vehement gegen Studien, die den strukturellen Rassismus in der Polizei untersuchen sollen, obwohl gerade People of Colour immer wieder durch Racial Profiling diskriminiert werden? Warum ist immer noch täglich in populären Medien von „Clan-Kriminalität im Shishabar-Milieu“ die Rede, während Bandenkriminalität von Deutschen nicht rassifiziert wird? Und warum wurde eine Gedenkveranstaltung in Hamburg sechs Monate nach der Tat durch die Polizei gestoppt bzw. in Hanau durch die Stadtverwaltung von vorneherein verboten, während im letzten Jahr an diversen Orten tausende Corona-Leugner*innen mit Rechtsextremen ohne Abstand und Maske marschieren durften?
Auch im Kreis Verden wird am ersten Jahrestag der Anschläge der Opfer gedacht.
Unter dem Motto „Say their names“ treffen sich „Die Omas gegen Rechts“ um 11 Uhr in der Verdener Fußgängerzone – Ecke Brückstraße.
Veranstaltungsankündigung Omas gegen Rechts
Bündnis 90 / Die Grünen ruft um 17 Uhr zur Mahnwache in Achim am Gieschen-Kreisel auf.
Niedersachsenweit gibt es in verschiedenen Städten Solidaritäts- und Gedenkveranstaltungen. Eine Übersicht hat der Flüchtlingsrat Niedersachsen zusammengestellt.